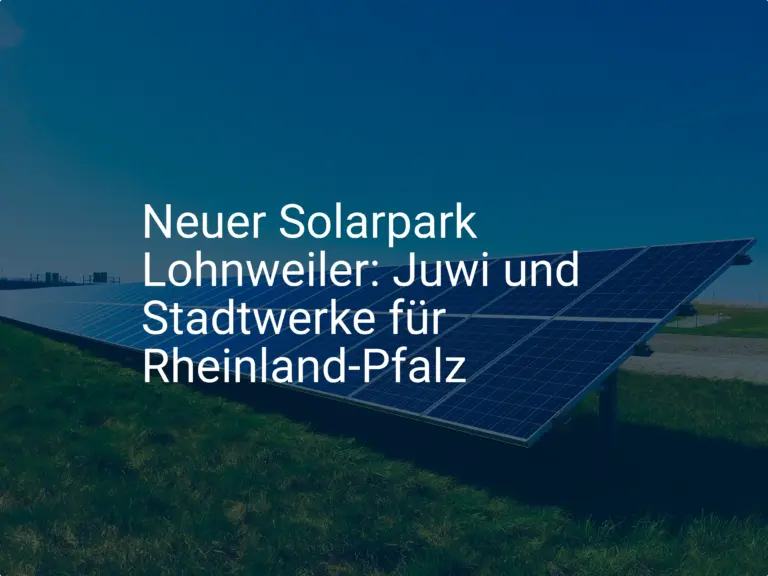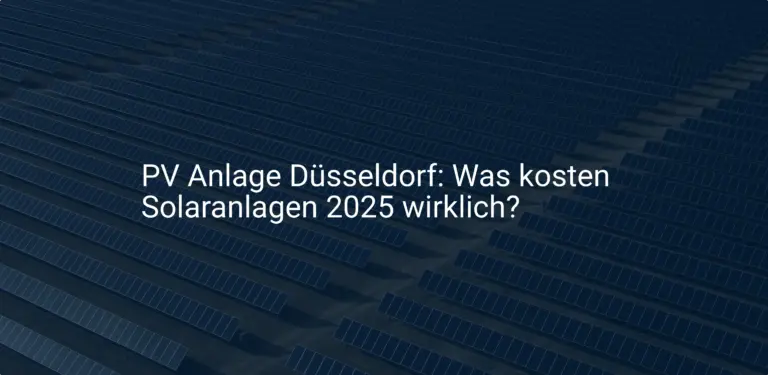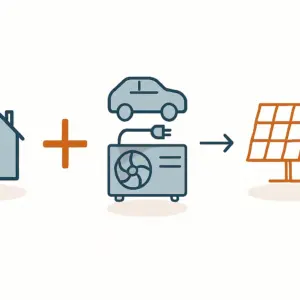Statkraft PV-Hybridkraftwerk Zerbst Anhalt: Inbetriebnahme für die Energiewende
Der norwegische Energiekonzern Statkraft hat in Zerbst, Sachsen-Anhalt, das größte PV-Hybridkraftwerk Deutschlands offiziell in Betrieb genommen. Das auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube errichtete Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Integration erneuerbarer Energien in das deutsche Stromnetz. Es kombiniert eine großflächige Photovoltaikanlage mit einem leistungsstarken Batteriespeicher und ist direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen, um die Netzstabilität zu fördern.
Technische Details des Statkraft PV-Hybridkraftwerks Zerbst
Das innovative Kraftwerk, das nach nur zwölf Monaten Bauzeit fertiggestellt wurde, setzt neue Maßstäbe für die Solarenergie in Sachsen-Anhalt. Auf einer Fläche von 41 Hektar wurde ein Solarpark mit einer Spitzenleistung von 46,4 Megawatt (MW) installiert. Dieser wird durch einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 16 MW und einer Kapazität von 57 Megawattstunden (MWh) ergänzt. Jährlich sollen hier knapp 50.000 MWh Grünstrom erzeugt werden, was dem Bedarf von rund 14.000 Haushalten entspricht und eine CO₂-Einsparung von etwa 32.000 Tonnen pro Jahr ermöglicht.
Das Projekt in Zerbst ist ein Beispiel für eine Hybrid-PV-Anlage im industriellen Maßstab. Solche Systeme, die Energieerzeugung und -speicherung kombinieren, werden auch für private Haushalte immer relevanter, um die Unabhängigkeit vom Stromnetz zu erhöhen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Bedeutung des PV-Hybridkraftwerks Zerbst für Netzstabilität und Energiemarkt
Die zentrale Aufgabe des Hybridkraftwerks ist es, die naturgemäß schwankende Einspeisung von Solarstrom auszugleichen. Der Batteriespeicher nimmt überschüssige Energie während sonnenreicher Stunden auf und gibt sie bei Bedarf, beispielsweise nachts oder bei hoher Nachfrage, wieder an das Netz ab. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Stabilität des Stromnetzes bei einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien zu sichern.
Zusätzlich wird die Anlage am Regelenergiemarkt teilnehmen. Dort hilft sie, kurzfristige Frequenzschwankungen im Stromnetz auszugleichen, eine Dienstleistung, die bisher vor allem von konventionellen Kraftwerken erbracht wurde. Christoph Vitzthum, CEO von Statkraft, betonte die strategische Bedeutung des Projekts: „Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein für Statkraft und ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Deutschland.“
Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie im Statkraft PV-Hybridkraftwerk Zerbst
Der Batteriespeicher in Zerbst ist das Herzstück der Anlage. Mit seiner hohen Speicherkapazität im Verhältnis zur Solarleistung kann er die erzeugte Energie sehr flexibel managen. Dieses Prinzip ist auch für private Anwender von Bedeutung. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für PV-Anlagen mit Speicher, um ihren Eigenverbrauch zu maximieren. Selbst für Mieter gibt es mittlerweile Balkonkraftwerke mit Speicher, die eine ähnliche Logik im kleineren Maßstab verfolgen.
Die durch die Vermarktung der Speicherleistung am Regelenergiemarkt erzielten Einnahmen tragen zur Wirtschaftlichkeit des Projekts bei und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Reservekraftwerken, was langfristig die Systemkosten der Energiewende senkt.
Statkraft und die Entwicklung erneuerbarer Energien in Sachsen-Anhalt, inklusive Zerbst/Anhalt
Für Statkraft, einen der größten Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa, ist die Anlage in Zerbst das erste eigenentwickelte Projekt dieser Art in Deutschland. Das Unternehmen plant, sein Portfolio an Wind-, Solar- und Speicherprojekten in Deutschland weiter auszubauen.
Das Bundesland Sachsen-Anhalt etabliert sich zunehmend als Vorreiterregion für innovative Energieprojekte. Der konsequente Photovoltaik-Ausbau wird durch weitere Großprojekte wie den geplanten Hybrid Wind Solar Park in Löberitz untermauert. Auch die lokale Gemeinschaft profitiert direkt: Die Stadt Zerbst/Anhalt erhält neben der Gewerbesteuer eine jährliche Kommunalabgabe von rund 100.000 Euro. Mit der Inbetriebnahme des Hybridkraftwerks leistet die Region einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaziele und zur Stärkung einer nachhaltigen Energieversorgung.