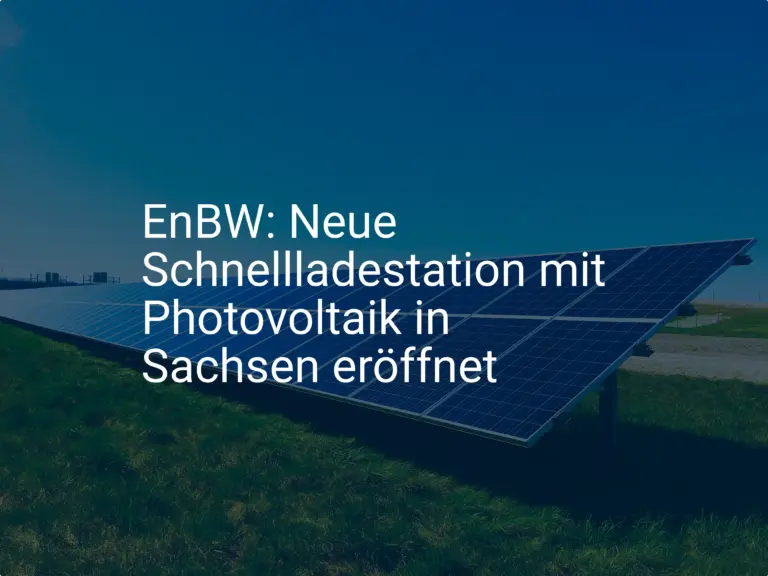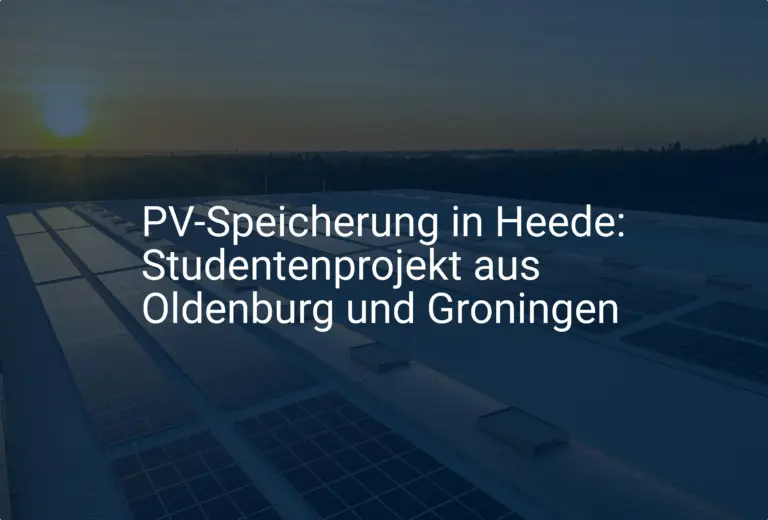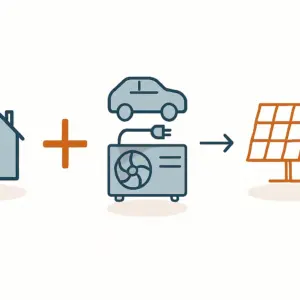Agri Photovoltaik Förderung in Sachsen: Doppelte Ernte für Energiewende
Sachsen plant, die Integration von Agri-Photovoltaik (Agri-PV) in der Landwirtschaft zu verstärken. Diese Technologie ermöglicht eine doppelte Flächennutzung durch die Kombination von Solarstromerzeugung und landwirtschaftlichem Anbau. Ein neues Forschungsprojekt namens APV-Resola II soll nun praxistaugliche Konzepte entwickeln, um die Technologie in Sachsen und Baden-Württemberg zu etablieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, ohne wertvolle Ackerflächen zu verlieren.
Agri-Photovoltaik: Mehr Flächennutzung in Sachsen
Agri-Photovoltaik gilt als Schlüsseltechnologie, um den Konflikt zwischen Energieerzeugung und Nahrungsmittelproduktion zu entschärfen. In Sachsen soll der Einsatz dieser Methode nun durch das Projekt APV-Resola II gezielt gefördert werden. Das sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) unterstützt das Vorhaben mit insgesamt 2,4 Millionen Euro. Ziel ist es, neue Modelle für die Agri-PV zu entwickeln, die nicht nur in Sachsen, sondern auch in Baden-Württemberg Anwendung finden sollen. In beiden Bundesländern ist der Ausbau der Solarenergie ein zentrales politisches Thema, wobei in Photovoltaik in Baden-Württemberg auch Kritik an fehlender Speicherlösung geübt wird, was die Bedeutung ganzheitlicher Konzepte unterstreicht.
Sachsens Energieminister Wolfram Günther hob die Relevanz der Technologie hervor: „Agri-PV kann einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Deshalb setzen wir auf die Forschung und Erprobung dieser Technologie, um sie für Sachsen voranzubringen.“ Durch die doppelte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen kann die Energiewende beschleunigt werden, ohne den Flächenverbrauch zu erhöhen – ein entscheidender Vorteil in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland.
Agri Photovoltaik Forschung in Sachsen: HTWK Leipzig als Pionier
Eine zentrale Rolle im Projekt APV-Resola II übernimmt die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Hier werden konkrete Modelle für den Praxiseinsatz entwickelt. Professor Volker Wittpahl von der HTWK Leipzig erklärte das Ziel: „Wir wollen untersuchen, wie Agri-PV so gestaltet werden kann, dass sie sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll ist.“ Die Forschung umfasst die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle sowie die Analyse der Umweltauswirkungen.
Die Initiative in Sachsen ist Teil eines bundesweiten Trends. An der Universität Hohenheim wird beispielsweise bereits eine 10 Meter hohe Forschungsanlage betrieben, um die Wechselwirkungen zwischen Solarmodulen und Ackerbau zu untersuchen. Ein weiteres innovatives Beispiel liefert der Energiekonzern Ørsted, der eine Freiflächen-Solaranlage in einem Dammwild-Gehege errichtet hat. Solche Projekte zeigen, wie vielseitig die Agri-PV eingesetzt werden kann.
Agri-Photovoltaik: Chancen und Herausforderungen für die Landwirtschaft
Für landwirtschaftliche Betriebe bietet die Agri-PV erhebliche Vorteile. Die Solarmodule schützen die Kulturen vor Wetterextremen wie Hagel, Starkregen und übermäßiger Sonneneinstrahlung. Dies kann besonders beim Anbau von empfindlichen Sonderkulturen wie Obst und Gemüse die Erträge stabilisieren und die Erntequalität verbessern. Gleichzeitig eröffnet die Stromerzeugung eine zusätzliche, wetterunabhängige Einnahmequelle.
Dennoch gibt es Herausforderungen. Die anfänglichen Investitionskosten für die Installation der aufgeständerten Anlagen sind höher als bei klassischen Freiflächenanlagen. Zudem muss die Technologie nahtlos in die bestehenden Betriebsabläufe integriert werden. Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist die effiziente Nutzung des erzeugten Stroms. Hier spielen Speichersysteme eine immer wichtigere Rolle, um den Solarstrom bedarfsgerecht verfügbar zu machen. Die Entwicklung neuer Technologien, wie die erste Natrium-Ionen-Batterie in Bremen, zeigt das Potenzial für sicherere und kostengünstigere Speicherlösungen der Zukunft.
Ausblick: Agri-PV vom Feld bis zum Balkon
Agri-Photovoltaik hat das Potenzial, die Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen und gleichzeitig die Energiewende zu beschleunigen. Das Projekt APV-Resola II ist ein wichtiger Schritt, um die Technologie in Sachsen und darüber hinaus zu etablieren.
Das Grundprinzip, verfügbare Flächen für die Gewinnung von Solarenergie zu nutzen, ist dabei universell anwendbar. Während Agri-PV eine Lösung für die Landwirtschaft darstellt, können auch Privatpersonen einen Beitrag leisten. Hausbesitzer haben die Möglichkeit, mit kompletten PV-Anlagen mit Speicher und Montagesets ihre eigene Energie zu erzeugen und zu speichern. Für Mieter und Wohnungseigentümer bieten sich Balkonkraftwerke mit Speicher oder einfachere Balkonkraftwerke ohne Speicher an, um unkompliziert eigenen Solarstrom zu produzieren und die Stromkosten zu senken.